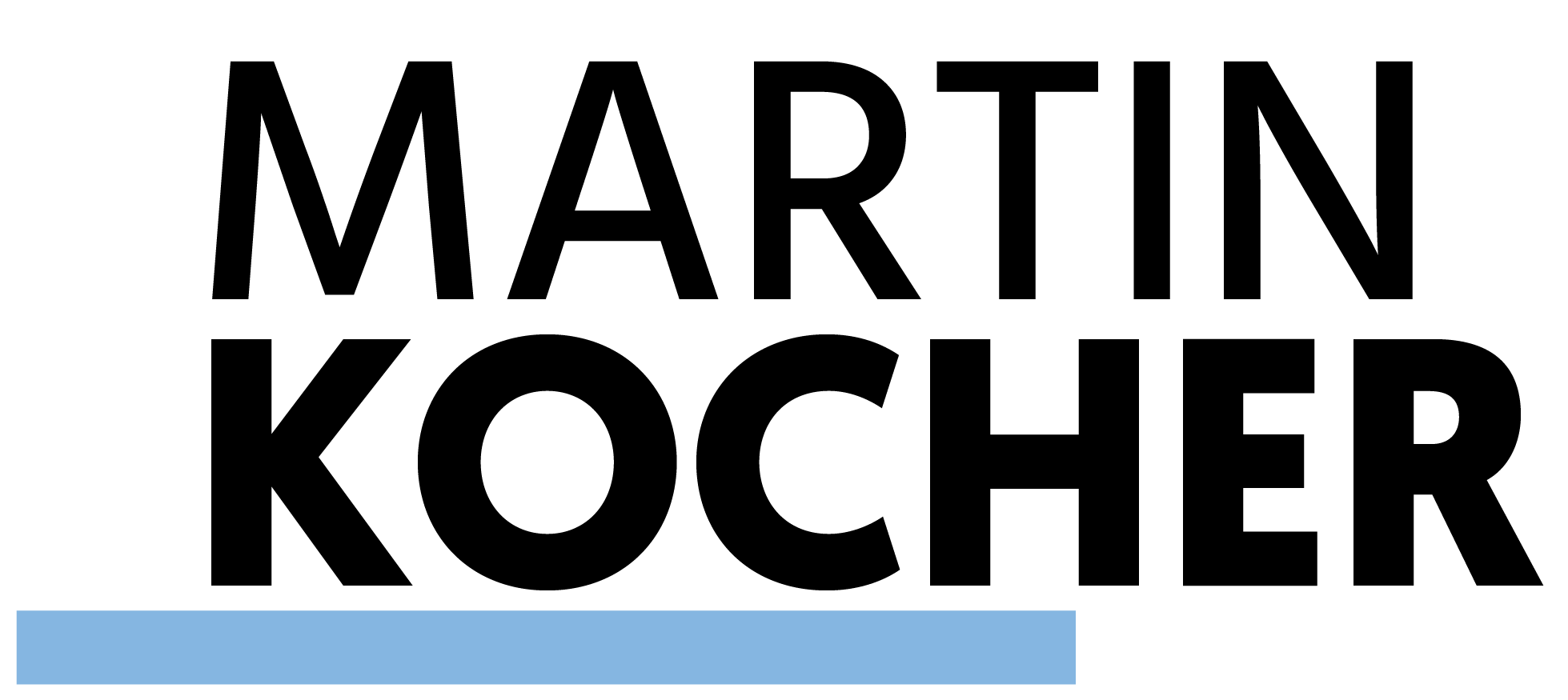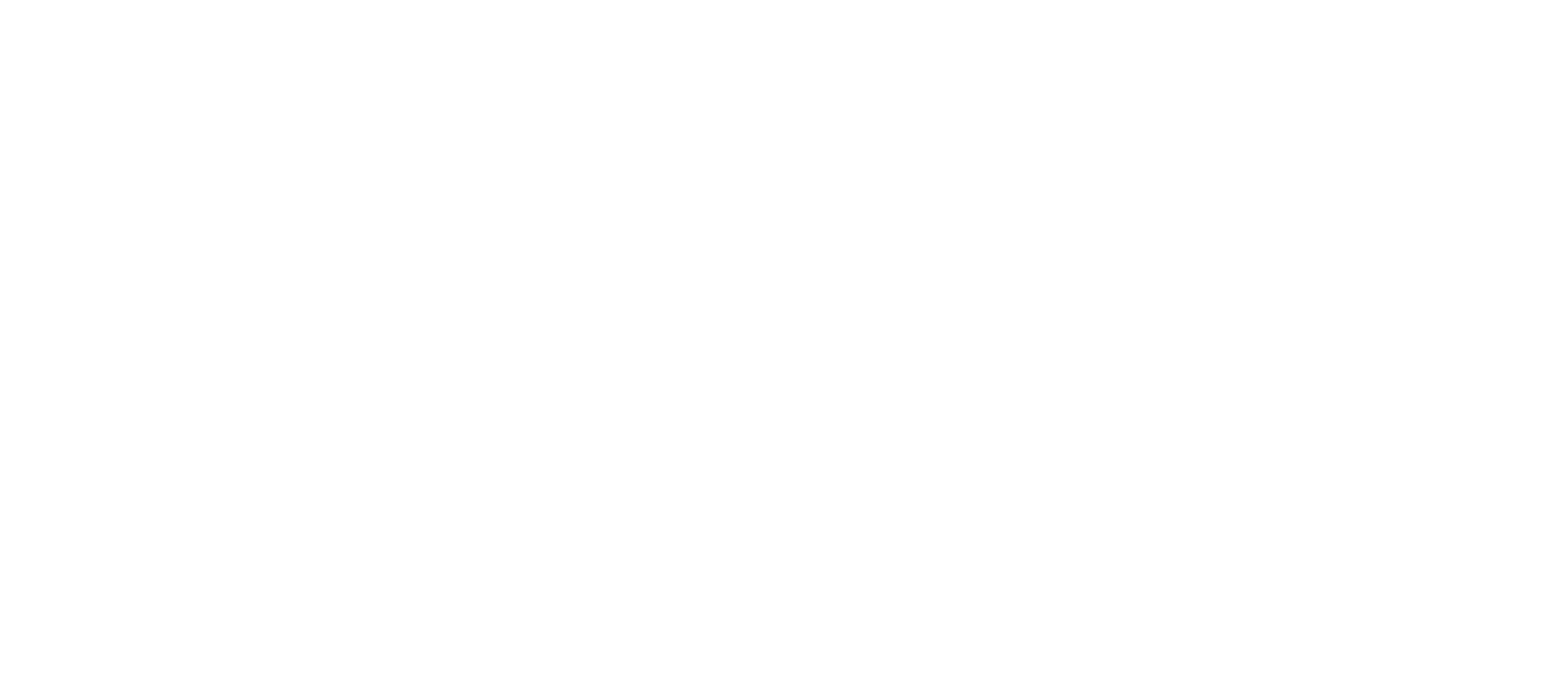Vor etwa 30 Jahren hat sich Folgendes ereignet: Die US Equal Employment Opportunity Commission hatte der Restaurant-Kette Hooters, bekannt für ihre leicht bekleideten Kellnerinnen, vorgeworfen, Anti-Diskriminierungsgesetze der USA zu verletzen, weil sie keine (männlichen) Kellner einstellen wollte. Die Wogen gingen damals hoch und gipfelten in einer Kampagne des Unternehmens mit dem Slogan „Washington – get a grip!“, also sinngemäß auf Deutsch: „Washington – reiß dich zusammen!“
Man könnte fast den Stehsatz der „guten alten Zeit“ bemühen, angesichts dessen, welche Entscheidungen aus Washington damals die Gemüter erregt haben und was derzeit in Washington entschieden, oder zumindest angekündigt, wird. Die US-Administration erhöht mit ihren erratischen Aussagen zu und manchen Handlungen in ihrer Wirtschaftspolitik die weltweite wirtschaftspolitische Unsicherheit. Sie greift etwa die Wissenschaftsfreiheit an, indem sie Universitäten in juristische Auseinandersetzungen zwingt. Und sie missachtet die Unabhängigkeit der Notenbank – nicht durch ständige Kritik an ihrer Geldpolitik (eine solche ist natürlich zulässig), sondern durch institutionelle Überlegungen auf Basis zweifelhafter juristischer Argumentation und mit dem klar formulierten Wunsch, die Staatsverschuldung der USA zu verbilligen.
Es ist zentrale Aufgabe jeder politischen Exekutive, die unvermeidbaren Unsicherheiten, die es in unserer Welt gibt, so gut es geht zu reduzieren. Allein das ist ein Wert einer guten Regierung an sich. Bewusst das Gegenteil zu tun, ist wirtschafts- und gesellschaftspolitisch kontraproduktiv.
Aber wahrscheinlich geht es der US-Administration – aus welchen Gründen auch immer (man kann nur spekulieren) – vor allem mediale Aufmerksamkeit. Insofern sollte man nicht auf jede Aussage oder jeden Social-Media-Post reagieren, sondern – auch wenn es angesichts der Zuspitzung schwer fällt – Gelassenheit und Langmut an den Tag legen.
Geldpolitik und Fiskalpolitik in demokratischen Staaten
Deshalb werde ich hier auch nicht auf Details eingehen, sondern lediglich kurz erläutern, warum die umfassende Unabhängigkeit von Notenbanken, die es historisch gesehen noch gar nicht allzu lange gibt (erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie sich in mehr und mehr Staaten durchgesetzt), ein unverzichtbarer Grundpfeiler jeder funktionierenden Demokratie und zugleich ein entscheidender Vorteil für alle Bürgerinnen und Bürger ist.
In Demokratien müssen sich Entscheidungsträgerinnen und -träger regelmäßig Wahlen stellen. Regierungen neigen im Allgemeinen dazu, sich die Unterstützung von Wählerinnen und Wählern in diesen Wahlen durch für diese vorteilhafte politische Maßnahmen zu sichern. Das können Steuerreformen, Förderungen oder sozialpolitische, arbeitsmarktpolitische, gesundheitspolitische und pensionspolitische Maßnahmen sein – um nur die wichtigsten Beispiele zu nennen. Das zentrale Problem: Die meisten dieser Maßnahmen kosten Geld. Schon vor etwa 50 Jahren haben viele Forschungsarbeiten gezeigt, dass die Ausgaben von Regierungen vor Wahlen im Durchschnitt nach (leicht) oben gehen und danach der Anstieg der Ausgaben wieder reduziert wird. Das gilt oft auch für die Budgetdefizite. Man spricht von politischen Konjunkturzyklen.
Diese politischen Konjunkturzyklen sind Teil der Demokratie. So lange die Wählerinnen und Wähler sie zulassen oder sogar fordern – und das tun übrigens Wählerinnen und Wähler aller Bildungsschichten – sind sie ein Bestandteil der Fiskalpolitik und treten regelmäßig auf; nicht bei jeder Wahl, nicht in jeder Konstellation, natürlich abhängig von der konjunkturellen und weltwirtschaftlichen Lage, aber auch von der politischen Konstellation und der Knappheit in den Umfragen, und daher in sehr unterschiedlichem Ausmaß (wir haben dazu vor mehr als 20 Jahren eine Forschungsarbeit veröffentlicht: Details hier).
Erfolgreiche Politikerinnen und Politiker in einer Demokratie können nicht immer nur an die positiven Effekte von Reformen in 20 oder 30 Jahren denken. Wenn sie NUR das tun, werden sie abgewählt. Das heißt natürlich nicht, dass langfristig sinnvolle Reformen in der Demokratie nicht möglich sind. Dabei geht es um Überzeugungsarbeit, gute Argumente und viel Erklärung, und sie gelingen leichter in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Generell scheint zu gelten: Wer als Politikerin oder Politiker ausschließlich an die lange Frist denkt, und die Gegenwart vergisst, ist schneller abgewählt als sie oder er schauen kann.
Die Auswirkungen von Änderungen der Fiskalpolitik spüren Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen recht oft rasch und sie können sie in der Regel auch recht gut einschätzen. Ratingagenturen und die Wissenschaft können fiskalpolitische Maßnahmen gut beobachten und analysieren, weil Haushaltspläne transparent sind. Im Gegensatz dazu wirken viele Instrumente der Geldpolitik komplexer und für die Allgemeinheit aufgrund ihrer Vielschichtigkeit weniger transparent.
Der Wert unabhängiger Notenbanken
Hat also eine Regierung die Hand nicht nur an der Fiskalpolitik (aus guten Gründen gibt es hier dennoch Einschränkungen innerhalb der Eurozone als nachhaltige Verpflichtung), sondern auch an der Geldpolitik, kann sie sich kurzfristig größere finanzielle Spielräume über niedrige Zinsen, über eine größere Geldmenge oder direkt über die Finanzierung von öffentlichen Ausgaben schaffen. All das – und die Wirtschaftsgeschichte bietet hier eindeutige Belege – erhöht die Inflation und kann im schlimmsten Fall zu einer galoppierenden Inflation oder einer Hyperinflation führen. Hohe Inflationsraten verursachen hohe Kosten für alle Beteiligten. Um genau das zu verhindern, gibt es die Unabhängigkeit der Notenbanken in der Geldpolitik als unverzichtbaren Schutzmechanismus zur Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität und zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger.
Die Geldpolitik ist in der Eurozone primär dem Inflationsziel verpflichtet. Die Unabhängigkeit von Notenbanken bezieht sich auf die Trennung zwischen Regierungen und Notenbanken, betrifft die Governance der geldpolitischen Institutionen und andere wichtige Aspekte ihrer Tätigkeiten. Sie ist vor allem eine Pflicht, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu handeln, unabhängig von parteipolitischen Interessen oder kurzfristigen Wünschen. Sie ist aus meiner Sicht aber auch eine Pflicht, transparent zu informieren und nachvollziehbar zu handeln. Unabhängige Notenbanken führen erwiesenermaßen zu höherer Preisstabilität, also zu weniger Inflation.
Die Unabhängigkeit von Notenbanken beinhaltet auch die Pflicht darauf hinzuweisen, wie gefährlich es ist, wenn an dieser Unabhängigkeit gerüttelt wird. Glücklicherweise gibt es dazu in der Eurozone keinen Anlass. In den USA gibt es diesen Anlass – also: „Washington – get a grip!“
Foto: Pexels/Pixabay