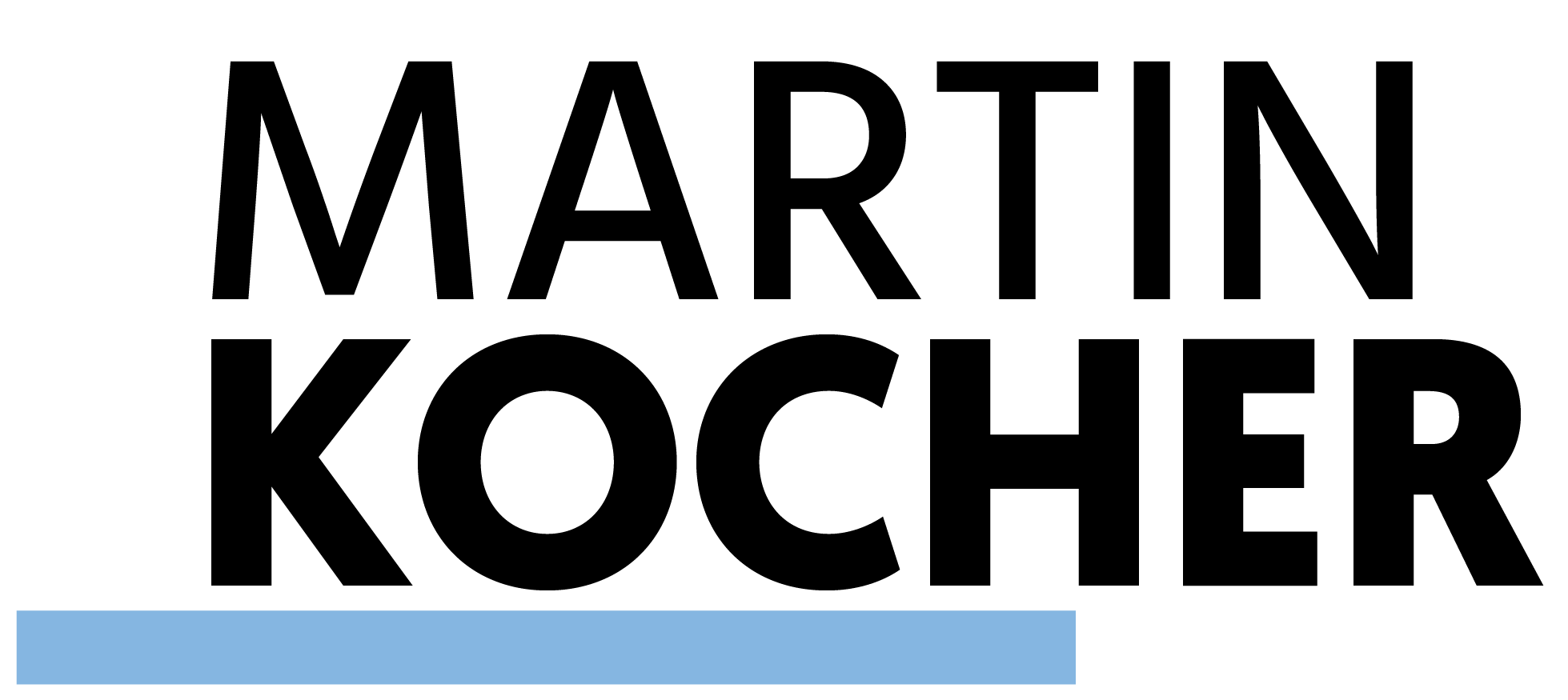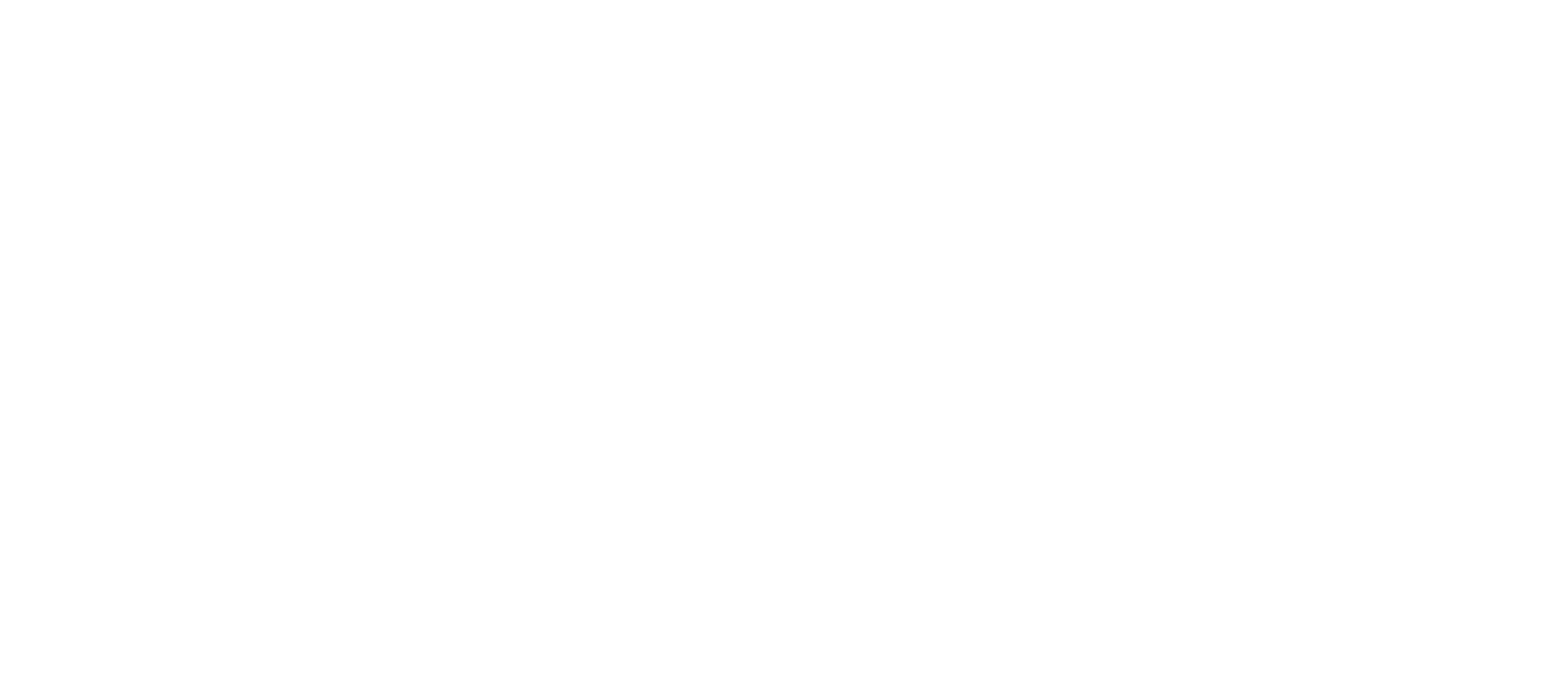Vor nun vier Jahren und fast zwei Monaten durfte ich die Aufgabe übernehmen, ein Bundesministerium zu leiten. Am 11.01.2021, bei Rekordarbeitslosigkeit und schweren Beeinträchtigungen der Wirtschaft durch die Folgen der Corona-Pandemie, übernahm ich das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend. Angesichts der dramatischen Arbeitsmarktlage war mein Wunsch – als “Lehrling” in der Politik – mich voll auf den Arbeitsmarkt konzentrieren zu können. So wurde ich am 01.02.2021, zum zweiten Mal, als Bundesminister für Arbeit angelobt und die restlichen Agenden des Ministeriums wanderten ins Bundeskanzleramt.
Seither ist viel passiert: Rückgang der Arbeitslosigkeit, Kanzlerwechsel, der russische Angriff auf die Ukraine, die Bestellung auch zum Wirtschaftsminister inklusive den Tourismusagenden, ein starker Anstieg der Energiepreise und Versorgungsunsicherheiten, und eine Rezession. Und vieles andere mehr. Regieren ist ein Leben in den Tag hinein. Der Terminkalender ist immer übervoll, aber jede Nachricht oder jeder Anruf kann alles über den Haufen werfen, was man monatelang geplant und vorbereitet hat.
Reagieren für Wissenschaftler?
Vieles, was in den letzten Jahren von der Regierung beschlossen wurde, war notwendigerweise manchmal mehr durch Reagieren als durch Regieren gekennzeichnet. Das hat mit der rezenten Häufung an unvorhersehbaren Ereignissen zu tun; aber es gab unvorhersehbare Ereignisse in fast jedem Jahrzehnt seit dem Zweiten Weltkrieg. In der Rückschau wirken sie dann oft nicht so überraschend. Insofern muss sich eine Regierung immer – selbst wenn es Unvorhersehbares gibt, an der Umsetzung des Regierungsprogramms messen lassen.
Ich nenne hier lediglich als Beispiele im Arbeitsbereich die umfassende Reform der beruflichen Weiterbildung im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (Fachkräftestipendium, Pflegestipendium, Bildungsbonus), die Reformen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte inklusive Einrichtung des interministeriellen Strategieausschusses und die besonders wichtigen Weiterentwicklungen bei der Geschlechtergleichstellung und bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt.
Im Rahmen des Erfolgsmodells der beruflichen Bildung wurden fast 100 Lehrberufe modernisiert, das Rahmengesetz für die Höhere Berufliche Bildung beschlossen und die Gebühren für Meister- und Befähigungsprüfungen abgeschafft. Viele der beschlossenen Maßnahmen haben die Innovationskraft Österreichs gestärkt: die Klima- und Transformationsoffensive, die Umsetzung des European Chips Act, neue FFG-Programme, höhere Innovationsförderungen bei der ACR und im Rahmen der CDG, um nur einige Beispiele zu nennen. Eine neue Gesellschaftsform die FlexCo, die erste neue Gesellschaftsform nach der GmbH, die vor mehr als 100 Jahren gesetzlich implementiert wurde, hilft Start-ups genauso wie die Spin-Off-Initiative oder der Gründungsfonds II.
Viele unserer Vorschläge wurden international beachtet und aufgenommen, wie unser Strategiepapier zur EU-Wettbewerbsfähigkeit oder Vorschläge zur Ausgestaltung von EU-Rechtsakten, wie der Lieferkettenrichtlinie oder zum Abbau von unnötiger Bürokratie (von denen gerade in den letzten Wochen von der EU-Kommission viele in das neue Arbeitsprogramm aufgenommen wurden). Die Intensivierung der Kontakte zu Ländern, die wichtige österreichische Exportmärkte beheimaten, war uns ein großes Anliegen, gerade weil auch die Diversifizierung der Import-/Exportbeziehungen Österreichs eine geopolitische Herausforderung unserer Zeit ist. Die EXPO in Osaka 2025 ist gut vorbereitet, und der Tourismus – hervorragend begleitet durch Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, konnte im letzten Jahr einen Nächtigungsrekord verzeichnen. Die Film- und Kreativwirtschaft konnten wir mit zielgerichteten Programmen und Initiativen genauso unterstützen wie unsere industriellen Schwerpunktbereiche, aber auch die vielen KMUs in Österreich.
Auch ressortintern gab es von Generalsekretärin Eva Landrichtinger unzählige Vorzeigeinitiativen. Das Ziel war es als BMAW, Vorbild als moderner Arbeitgeber zu sein.
Reformen
Aber klar: Die GANZ großen Reformen sind in den letzten fünf Jahren zu selten zustande gekommen. Die Arbeitsmarktreform hat genauso wenig die nötige koalitionäre Einigkeit gefunden, wie eine Reform der Bildungskarenz (eigentlich eine Reform der Fachkräfteausbildung im Erwachsenenalter) oder eine noch viel stärkere Senkung der Lohnnebenkosten. Auch das Arbeiten im Alter wurde nur unzureichend attraktiver. Ebenso wären mehr Maßnahmen zur Ermöglichung und Attraktivierung von Vollzeit nötig gewesen und zur Geschlechtergleichstellung am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft. Die ersten Schritte zu “Lohn statt Taschengeld” für Menschen mit Behinderungen sind gesetzt, aber hier braucht es noch viel umfassendere Anpassungen, um den Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten. Ich freue mich, dass der Koalitionspakt der Nachfolgeregierung bei einigen dieser Punkte Schritt für Schritt weitergeht. Das bestätigt unsere Schwerpunktsetzung.
Warum gelang es nicht, noch mehr Schritte zu setzen? Einerseits war es zweifelsfrei der Fall, dass Reformnotwendigkeiten 2024 andere waren als 2019, als die Koalitionsvereinbarung verhandelt wurde. Ein einfaches Beispiel aus einem anderen Bereich: In der Klimapolitik war vereinbart, die erneuerbare Energieerzeugung – also Windkraft und Solarenergie – massiv auszubauen. Damals war klar, dass man als Brückentechnologie zur Abdeckung der Grundlast einige Zeit billiges Erdgas zur Stromerzeugung verwenden kann. Der russische Angriffskrieg hat diese Strategie zerstört, und der rasche Ausbau der Netze und der Speicherung ist damit viel wichtiger geworden, weil Erdgas teilweise zu teuer ist. Der politische Switch vom Erneuerbarenausbau zur Großreform der gesamten Strominfrastruktur und der Neuaufstellung aller Player (durch den Föderalismus immer mit einem 2/3-Mehrheitserfordernis) gelang nur unzureichend.
Manche Reformen, gerade im Umfeld von Arbeitsmarkt-, Industrie-, Wirtschafts- und Steuerpolitik scheiterten an zu wenig Einigkeit unter den Sozialpartnern. Angesichts einer Regierung, an der die SPÖ nicht beteiligt war, die ÖVP aber schon – und der damit zusammenhängenden Asymmetrie unter den Sozialpartnern – ist es irgendwie verständlich, dass die Sozialpartner zu selten gemeinsamer Reformmotor sein konnten, auch wenn die gesetzlich herausgehobene Stellung der Sozialpartner die parteipolitischen Aspekte in den Hintergrund drängen sollte. Die neue Regierung, in der ÖVP und SPÖ vertreten sind, wird auch ein Lackmustest für die Lösungskompetenz der Sozialpartnerschaft in Österreich, wenn es um die großen Reformen geht. Aber all das werden dann die Historikerinnen und Historiker bewerten.
Zuletzt
Ich durfte ein Ministerium leiten, das groß, spannend und vielseitig war. Vielen Dank an Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Generalsekretärin Eva Landrichtinger, mein Kabinett unter Kabinettschef Paul Rockenbauer und seinem Stellvertreter Severin Gruber, an die Führungskräfte des BMAW, an die Personalvertreterinnen und -vertreter und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ressort und in den aus- und nachgelagerten Einheiten (dazu zählen etwa das AMS, das BEV, die FFG, die AWS, die BHÖ, die SKB, der Zoo Schönbrunn, das Beschussamt, der IEF, die Bundesmobiliengesellschaft, uvm.). Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung und in allen mit uns zusammenarbeitenden Institutionen, allen Stakeholdern, den Sozialpartnern, den Interessenvertretungen, den Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, den uns beratenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Abgeordneten im Parlament, den zuständigen Mitgliedern der Landesregierungen, den Mitgliedern unserer Arbeitsgruppen bzw. Räten, Unternehmerinnen und Unternehmern und allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich – ich durfte so viele kluge und interessante Menschen kennenlernen und mit vielen von ihnen eng zusammenarbeiten, dass die Aussicht schwer fällt, einige von ihnen in der nächsten Zeit nicht mehr so oft sehen zu können.
Für mich persönlich ging es darum, die richtige (und manchmal nicht ganz einfache) Balance zwischen einem wissenschaftlichen Zugang und dem politischem Zug zum Tor zu halten, um möglichst viele sinnvolle Maßnahmen umzusetzen; die “Lehre” als parteifreier Regierungspolitiker habe ich nach mehr als vier Jahren, glaube ich, abgeschlossen. Die Anforderungen an das politische Management in einem der größten Ressorts der Geschichte waren auch nicht von der Hand zu weisen. Insofern war die persönliche Erfahrung, die ich machen durfte, eine ganz besondere. Es war eine große Ehre und ein großes Privileg, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft sein zu dürfen. Aber auch die Geldpolitik ist Teil der Wirtschaftspolitik – daher darf ich weiterhin österreichische und europäische Politik gestalten – dann unabhängig von Regierungen und Parteien. Ab 01.09. als Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) warten neue Herausforderungen, über die ich natürlich weiter hier berichten werde.
Foto: BMAW/Holey